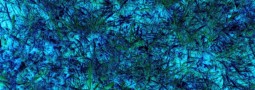![Künstler Burgy Zapp [http://burgyzapp.de]](http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//pa0_117-1781_IMG_Z_nf_o-300x300.jpg)
Künstler Burgy Zapp [http://burgyzapp.de]
Diesen Monat beginnt in Europa ein großes, unbekanntes Abenteuer:
der Zusammenschluß der Währungen aus elf Ländern.
In den letzten Wochen des alten Jahres wurde offenbar, wie schlecht einige Unternehmen auf die Umstellung vorbereitet sind und wie gering der Informationsstand ist. Vorbereitungs- und Informationsstand lassen sich teilweise durch die „Weder-Noch-Regel“ (siehe Kasten) erklären, die eine gewisse Flexibilität bei der Umstellung einzelner Währungen zuläßt und niemanden zur sofortigen Euro-Einführung zwingt. Doch es verfestigt sich der Eindruck, als ob dem Euro das gleiche Schicksal wie vor ein paar Jahren der Umstellung aufs Jahr 2000 widerfährt: Erstmal schiebt man alles auf die lange Bank, und im letzten Moment müssen dann Hals über Kopf wichtige Entscheidungen getroffen werden. Es wird gerade so getan, als würde es die von den Regierungs- und Staatschefs als notwendig erachtete Übergangsphase nie geben.
Meilensteine
Nur wenigen Europäern ist bewußt, daß vor wenigen Tagen ein wichtiger Startschuß gefallen ist. Ab jetzt können auf Wunsch alle Zahlungen in Euro erfolgen. Daß dieser Tatsache so wenig Beachtung geschenkt wird, liegt vielleicht daran, daß zunächst noch kein greifbares Geld in Umlauf ist. Doch seit dem 1. Januar 1999 (genauer: seit Montag, 4. Januar, dem ersten Arbeitstag des neuen Jahres) haben alle Währungen der WWU-Teilnehmerländer (siehe Infokasten und Abb. 1) ihre Autonomie verloren und sind zum Bestandteil des Euro (EUR) geworden.
Damit hat Phase 3 der Euro-Implementierung begonnen. Der Euro wird gültiges Buchgeld, kann also als Währung im bargeldlosen Zahlungsverkehr (Schecks, Wechsel, Überweisungen u.s.w.) eingesetzt werden. Der Euro wird zur offiziellen Währung für alle Finanzinstitute der WWU-Teilnehmerländer (Finanzmärkte, Devisenmärkte, Bankgeschäfte), alle Transaktionen werden in Euro abgewickelt. Um dies zu erreichen, sind nach Artikel 109L.4 des EU-Vertrags die Wechselkursparitäten der 11 Währungen zum Euro ab 1. Januar 1999 unwiderruflich fixiert. Gleichzeitig wird der ECU (European Currency – Europäische Währungseinheit) im Verhältnis 1 zu 1 durch den Euro ersetzt (Artikel 109G.2). Der mit Inkrafttreten des Europäischen Währungssystems (EWS) 1979 eingeführte ECU war eine „Korbwährung“, die sich aus den gewichteten Währungen von zwölf der fünfzehn Währungen der EU-Mitgliedstaaten zusammensetzte. Es ist leicht nachvollziehbar, daß der ECU, je nach Kurs der im Korb befindlichen Währungen, in der Vergangenheit fluktuierte. Aufgrund der festen Wechselkurse kann das mit dem Euro nicht passieren.
Die geschilderten Ereignisse haben weitreichende Konsequenzen für die europäischen Banken. So beläuft sich beispielsweise der entgangene Gewinn aufgrund des Wegfalls der Umtauschprovisionen auf schätzungsweise bis zu 30 Milliarden Dollar. Ab diesem Monat wird Europa zu einem voll konkurrenzfähigen Bankplatz, und die Bankinstitute müssen sich mächtig anstrengen, wenn sie ihre Besonderheiten, wie beispielsweise das Wertstellungsverfahren oder die kostenlose Kontoführung beibehalten möchten. Da es den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, möchte ich nicht näher auf dieses Thema eingehen.
Der 1. Januar 2002 läutet eine weitere Phase ein: der Euro wird zum gesetzlichen Zahlungsmittel und als Bargeld eingeführt. Ab diesem Stichtag und in Anwendung der Artikel 1 und 5 der Euro-Einführungsverordnung verlieren alle während des Übergangszeitraums geltenden Regeln ihre Gültigkeit. Mit anderen Worten, alle Geschäfte müssen in Euro getätigt werden. Es folgt eine Übergangsfrist von 6 Monaten, also bis zum 30. Juni 2002, in der die jeweilige alte Landeswährung noch geduldet wird. Dieses halbe Jahr betreffend, sind schon Anekdoten wie die folgende in Umlauf: Angenommen, der Umrechnungskurs für die Deutsche Mark wird mit 1,95 DM pro 1 EUR festgelegt (der exakte Kurs stand bei Drucklegung noch nicht fest). Man stelle sich folgendes Szenario vor: Fritzchen geht zum Bäcker, um ein Brot für DM 2,40 zu kaufen. Er zahlt mit einem Zweimarkstück und 25 Cent (ein Cent ist ein hundertstel Euro). Frage: Wieviel Rückgeld bekommt Fritzchen vom Bäcker? Antwort: Entweder 4 oder 5 Cent. Wenn er 4 Cent zurückbekommt, kann Fritzchen sich über zuwenig Rückgeld beschweren, wenn er 5 Cent zurückbekommt, büßt der Bäcker einen Bruchteil seiner Gewinnspanne ein. Es wird jedoch so sein, daß in den Geschäften zwar die alte Landeswährung als Zahlungsmittel angenommen werden muß, als Rückgeld jedoch nur Euros ausgegeben werden dürfen.
|
WWU-Teilnehmerländer, potentielle Teilnehmerländer und Nicht-WWU-Teilnehmerländer
Am 2. Mai 1998 wurde der Teilnehmerkreis der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) an der am 1. Januar 1999 beginnenden Phase 3 ausgewählt. Die Länder wurden in drei Kategorien unterteilt: |
Rechtliche Folgen
Die Richtlinien des Europäischen Rats sehen vor, daß die jeweilige Landeswährung und der Euro vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, zwei unterschiedliche Bezeichnungen ein und derselben Währung sind, und daß beide Währungen rechtlich gesehen gleichwertig sind, solange es nationale Währungseinheiten gibt. Daher können juristische Vereinbarungen während des Übergangszeitraums sowohl in Euro als auch in einer Landeswährung getroffen werden. Ein Geschäftspartner kann vom anderen sogar verlangen, ihm eine Rechnung in Euro auszustellen, die er dann aber in der Landeswährung bezahlt, oder ihm eine Rechnung in der von ihm gewünschten Landeswährung auszustellen. Weiterhin wird für alle juristischen Vereinbarungen, die vor dem 1. Januar 1999 getroffen wurden, der Status Quo beibehalten. In Anwendung von Artikel 3 und 7 der Euro-Verordnung wird ab dem 1. Januar 1999 eine Schuld von beispielsweise 1000 D-Mark in Euro umgerechnet, aber noch in D-Mark angezeigt; der Wert bleibt gleich. Die praktische Umsetzung dieses Prinzips der Vertragskontinuität wird durch die unwiderrufliche Fixierung der Wechselkursparitäten erheblich erleichtert. Bei Verträgen zwischen Partnern aus EU- und Nicht-EU-Ländern ist es jedoch angebracht, die Vertragsklauseln sehr genau zu verifizieren und beim geringsten Zweifel entsprechende Nachbesserungen vorzunehmen.
|
Die Weder-Noch-Regel
Diese Regel ist der wichtigste während der Übergangszeit bis zur Einführung der gemeinsamen Währung geltende Grundsatz. „Weder Gebot noch Verbot“, das wurde beim Treffen des Europäischen Rats vom 15.-16. Dezember 1996 in Madrid beschlossen. Nach dieser Regel können alle Geschäfte entweder in Euro oder in einer Landeswährung getätigt werden, sofern sie nicht unmittelbar mit dem Geldmarkt zu tun haben. Seit dem 1. Januar 1999 ist die Verwendung des Euro im bargeldlosen Zahlungsverkehr weder obligatorisch noch verboten. Dies bleibt so bis zum 1. Januar 2002, wenn der Euro endgültig zum gesetzlichen Zahlungsmittel wird. Während der Übergangszeit ist es aber beispielsweise nach wie vor nicht möglich, in Frankreich mit D-Mark zu bezahlen; eine Landeswährung bleibt auf das Staatsterritorium beschränkt, in dem sie vor dem 1. Januar 1999 gesetzliches Zahlungsmittel war. |
Auswirkungen auf die Wirtschaft
Für Unternehmen bedeutet die Einführung der gemeinsamen Währung mehr als nur den Austausch einer Währung gegen eine andere. Die Umstellung auf den Euro ist vielmehr ein strategisches Projekt, das nicht nur alle funktionalen Bereiche sondern auch das Management betrifft.
- 7 Euro/Monat NEWSabo digital - sofort zugreifen.
- 13,5 Euro/Monat NEWSabo plus inklusive 5x Login & Print-Ausgabe - sofort zugreifen.